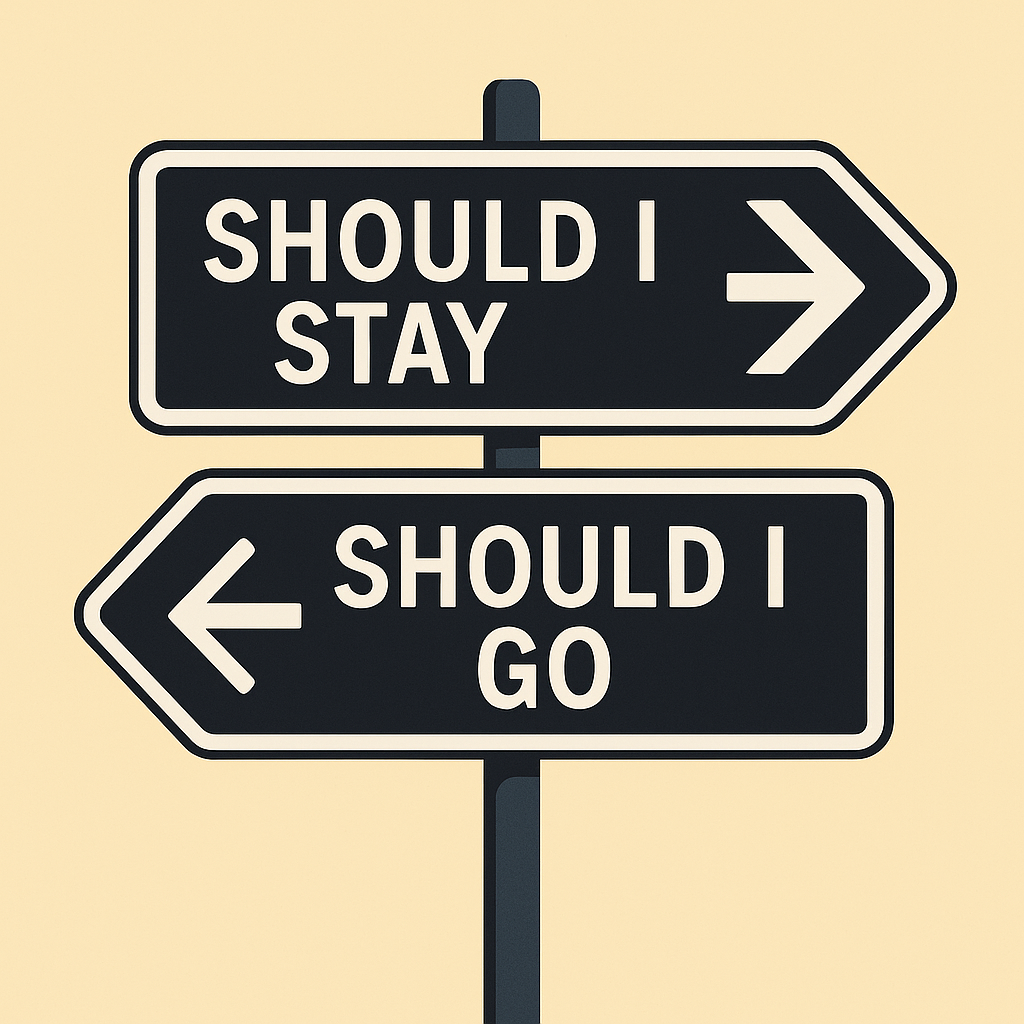Seit dem Liberation Day vom 2. April habe ich begonnen, eine Liste der Zolldrohungen, Zolleinführungen und Zollaufhebungen von Trump zu führen. Bei Zeile 150 habe ich aufgehört – ich habe schlicht den Überblick verloren. Dieses Hin und Her hat zwei schlechte, aber auch eine gute Nachricht.
Die schlechteste: Es gibt wieder massiv hohe Zölle. Das ist eine beschleunigte Abkehr von der Weltordnung, die uns zuletzt reich gemacht hat. Die Zeiten der Globalisierungs- wie auch der Friedensdividende sind vorbei. Trump verstärkt diese Entwicklung nur, sie besteht schon länger.
Ebenfalls schlecht: die Unsicherheit. Sie ist Gift für Investitionen.
Die gute Nachricht: Wo Volatilität herrscht, hat Nichts Bestand. Was heute hoch ist, sinkt morgen oft wieder – und umgekehrt. Genau das meinte US-Finanzminister Scott Bessent, als er sagte: „Die Zölle werden wieder schmelzen wie Eisblöcke.“
Doch die Frage bleibt: Wann?
Warum Trump Zölle liebt
Die Motivation für Zölle lässt sich in vier Kategorien fassen:
- Strukturell (Finanzquelle, China disziplinieren, Handelsbilanzdefizite verringern)
- Thematisch (Fentanyl, Migration)
- Ansiedelung (Pharma, Chips, strategische Industrien)
- Druckmittel (Rüstungskäufe, geopolitische Deals)
Zwei Hauptrichtungen stechen hervor: Staatseinnahmen und Industriepolitik.
Staatseinnahmen
In den USA haben Trumps Zollerhöhungen die Einnahmen umgerechnet auf rund 350 Milliarden Dollar steigen lassen. Der durchschnittliche Zollsatz liegt inzwischen bei 17,7 %. Das klingt eindrücklich – deckt aber gerade einmal ein Fünftel des jährlichen Budgetdefizits von 1’900 Milliarden.
Zölle sind damit keine Lösung für die US-Haushaltsprobleme. Doch „moderate“ Zölle von 10–15 % bleiben eine verlockende Einnahmequelle – für Trump wie für künftige Präsidenten. Diese Zölle dürften also bleiben und wohl auch einen Regierungswechsel überdauern.
Industriepolitik
Wie schwierig es ist, mit Zöllen Industriepolitik zu betreiben, zeigen aktuelle Beispiele:
- Autoindustrie: Dank USMCA zahlen Kanada und Mexiko auf viele Fahrzeuge und Teile deutlich tiefere Zölle (0,3 % bzw. 14,2 %) als vergleichbare Länder. Autoteile aus China sind hingegen mit fast 68 % belastet. Das Resultat: Endmontage in Kanada lohnt sich mehr als in den USA – das Gegenteil von Trumps Ziel.
- Costa Rica: Importe werden mit 15 % belegt, höher als bei Nachbarländern. Grund ist das Handelsplus aus Mikrochip-Exporten von Intel. Ironie des Schicksals: Die US-Regierung hält selbst 10 % an Intel und schmälert so ihre eigene Investition.
- Gold: Ende Juli stufte die US-Zollbehörde Schweizer Barren plötzlich als „Handelsgut“ ein. Folge: Lieferstopp, Futures-Preise im Himmel, Marktpanik. Prompt ruderte das Weisse Haus zurück.
Diese Beispiele zeigen: Trumps Versuch, die US-Wirtschaft mit Zöllen zu stärken, produziert widersprüchliche Folgen. Auf Zölle verzichten wird er dennoch kaum. Im Gegenteil: Bei jedem neuen Problem dürfte er an einer anderen Zollschraube drehen – oder zumindest damit drohen. Ruhe kehrt so in die Weltwirtschaft nicht ein.
Stoppen die US-Konsumenten die Zölle?
Zölle sind Steuern. Und am Ende zahlen die Konsumenten die Zölle – also auch Trumps Wähler. Je preisinelastischer ein Gut, desto schneller schlagen die Kosten durch. Erste Analysen deuten darauf hin, dass dies bereits geschieht: Die Zolleinnahmen steigen stärker, als Importmengen und Produzentenpreise es erwarten liessen. Vorratskäufe und Zollpausen verzögern die Preisweitergabe zwar, aber nicht dauerhaft.
Dass Zölle auch für die Amerikaner teuer werden, zeigte sich schon in Trumps erster Amtszeit: 2018 eingeführte Abgaben auf Waschmaschinen führten zu Preissteigerungen von 12 %. Auch nicht betroffene Trockner verteuerten sich. Die Folge: Mehrkosten von 1,5 Milliarden Dollar – rund 820’000 Dollar pro neu geschaffenem Arbeitsplatz. Viele Jobs waren es nicht.
Doch bis solche Nebenwirkungen schmerzen, vergeht Zeit – und Trump findet rasch Sündenböcke für schwächeres Wachstum oder höhere Inflation. Nebenbemerkung: Bereits heute misstraut er seiner eigenen Aussage, wonach die US-Wirtschaft boomt und das goldenen Zeitalter vor der Türe steht, indem er Zinssenkungen zur Unterstützung der Wirtschaft fordert.
Fazit für die Schweiz
Ein Grundzoll wird bleiben und würde selbst einen Regierungswechsel überdauern. Strafzölle werden weiterhin kommen und gehen, aber nie ganz verschwinden. Das ist die neue Realität. Die 39-Prozent-Straffzölle werden demnach wieder gesenkt werden. Das Risiko ist aber auch hoch, dass der 15-Prozent-Zoll der EU steigen wird.
Wie unberechenbar die Lage ist, zeigt Trumps eigene „Formel“ aus dem Rosengarten: Höhe des Handelsbilanzdefizits im Verhältnis zum Handelsvolumen – und dann noch geteilt durch zwei. Das schafft durchaus „Hoffnung“. Nach dieser Logik läge der Zoll im Januar, Februar und März – ebenso wie im Juli – tatsächlich bei rund 40 %. Im April und Mai hingegen wäre er dank der Volatilität im Goldhandel negativ oder gar null.
Die Frage nach dem «wann» kann ich nicht beantworten. Es bleibt nur, vorbereitet zu sein auf alle Eventualitäten. Vielleicht gilt auch hier die Lektion von The Clash: Der Song brauchte zehn Jahre, um ein Welthit zu werden – manchmal ist Geduld die einzig wirksame Strategie.