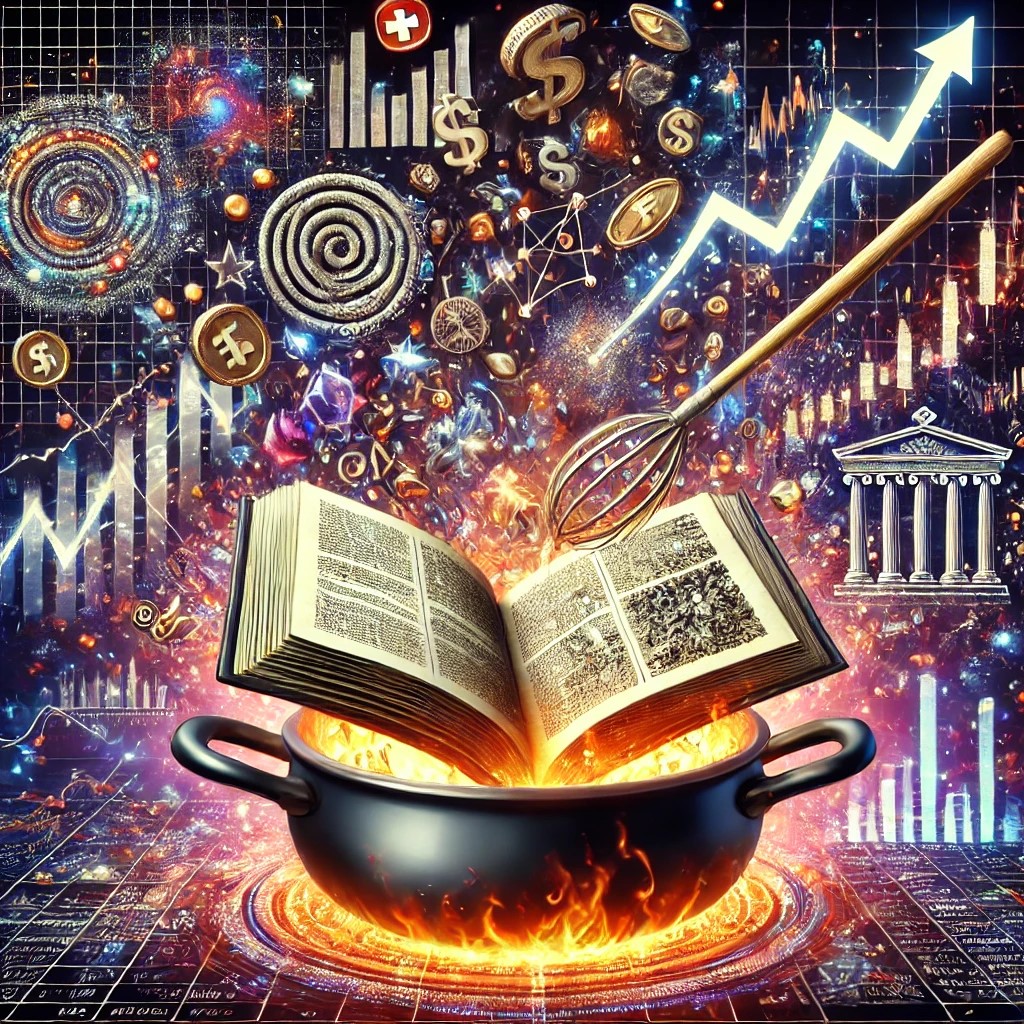Wie entwickeln sich die Schweizer Zinsen?
Langfristzinsen: Kürzlich habe ich dargelegt, dass die Zinsen für Anleihen und Kredite mit längeren Laufzeiten stark durch globale Entwicklungen beeinflusst werden. Insbesondere in den USA sind sie zuletzt deutlich gestiegen. Die Rückkehr der «Bond Vigilantes» könnte den Druck auf noch höhere Zinsen verstärken (siehe Blog: Happy 2035). Doch um es klarzustellen: Das Risiko eines sprunghaften Anstiegs der Zinsen ist derzeit gering. Die Federal Reserve (Fed) würde nicht zulassen, dass die US-Zinsen deutlich weiter steigen – Quantitative Easing (QE) wäre eine mögliche Reaktion. Nicht als «Einknicken» vor Trump, sondern weil Zölle und wirtschaftliche Abschottung langfristig auch deflationär wirken können, etwa durch Kaufkraftverluste und negative «Animal Spirits». Innerhalb eines solchen Szenarios würde auch der sichere Hafen Schweizer Franken verstärkt gesucht und Schweizer Langfristzinsen zusätzlich nach unten getrieben.
Kurzfristzinsen: Das kurze Ende der Zinskurve, welches die Grundlage für variable Hypotheken bildet, wird direkt von der SNB gesteuert. Sie trifft sich Mitte März erneut, um ihren Leitzins festzulegen. Zeit für eine detaillierte Prognose:
Das SNB-Kochbuch
Geldpolitik kann man mit einem Kochrezept vergleichen („Reaction Function“): Verschiedene Zutaten müssen berücksichtigt und abgewogen werden.
Die Zutaten:
- Teuerung: Die Wahrung der Preisstabilität ist der Kernauftrag der SNB. Preisstabilität wird als Inflation zwischen 0 % und 2 % in der mittleren Frist definiert.
- Wechselkurs: Hierbei steht besonders der EUR/CHF-Kurs im Fokus. Zwischen 2011 und 2015 gab es sogar eine explizite Wechselkursuntergrenze. Die Währungspolitik dient nicht primär der Exportindustrie, denn die Schweiz hat ein Handelsbilanzdefizit mit der EU. Wichtiger ist die Auswirkung auf Preise und Zulieferer-KMUs.
- Zinsdifferenz zum Ausland: Die Schweiz hat strukturell tiefere Zinsen als die EU. Diese Differenz beeinflusst den Wechselkurs (und umgekehrt). Erwartete Zinserhöhungen in der Schweiz würden den Franken aufwerten.
- Markterwartungen: Diese beeinflussen wiederum Zinsen und Wechselkurse.
- Konjunkturprognose: Die Auslastung der Wirtschaft beeinflusst das Preisniveau und die Inflationserwartungen.
- Finanzstabilität: Risiken für Banken und Immobilien spielen ebenfalls eine Rolle.
Zubereitung für die März-Lagebeurteilung
Die bedingte Inflationsprognose der SNB vom Dezember bietet den ersten Anhaltspunkt. Besonders relevant ist der am weitesten entfernte Datenpunkt – aktuell Q3 2027 mit einer erwarteten Inflation von 0,7 %. Ein Wert in der Mitte des Zielbands signalisiert keinen unmittelbaren Handlungsbedarf.
Die entscheidende Frage ist nun, ob die SNB im März ihre Inflationsprognose gegenüber Dezember ändert. Dabei helfen bereits erste Daten aus der Preiserhebung des Bundesamtes für Statistik (BFS): Die SNB prognostizierte für Q4 2024 eine Inflation von 0,7 % und für Q1 2025 0,3 %. Die bisher veröffentlichten Zahlen des BFS bestätigen diese Annahmen grösstenteils. Unsere Modelle zeigen aktuell keine grösseren Veränderungen im Inflationsausblick, welche in naher Zukunft zu erwarten sind (die Teuerung wird nicht stärker fallen als im Dezember angenommen).
Wenn sich der Inflationsausblick aber nicht wesentlich ändert, gibt es keinen Grund für eine weitere Zinssenkung. Die SNB hatte im Dezember den Leitzins bereits ungewohnt stark gesenkt, nachdem die Inflation wiederholt überraschend tief war. Die Strategie der SNB war es, frühzeitig und entschlossen zu handeln, um die Inflation wieder zu erhöhen.
Kurz: Warum sollte sie im März bei unverändertem Inflationsausblick erneut die Zinsen senken? Hätte sie dies für notwendig gehalten, wäre es bereits im Dezember geschehen («Medizin lieber früher verabreichen»).
Weitere Zutaten berücksichtigen
- Wechselkurs: Der EUR/CHF notiert stabil, der Euro ist sogar stärker als im Dezember. Der USD hat ebenfalls um mehr als 2 % zugelegt. Durch die tiefere Inflation in der Schweiz wertet der Franken real weiter ab – das ist sogar positive für die preisliche Wettbewerbsfähigkeit. Falls der sichere Hafen Franken stärker gesucht würde (z. B. durch geopolitische Unsicherheiten), wären Devisenmarktinterventionen als flexibleres Instrument möglich. Erst bei strukturellen Verwerfungen wäre eine Zinssenkung sinnvoll.
- Zinsdifferenz zum Ausland: Falls andere Zentralbanken ihre Leitzinsen stärker als erwartet senken, könnte die SNB unter Druck geraten (eine zu grosse Zinsdifferenz würde den Franken aufwerten lassen). Aktuell deuten internationale Trends jedoch eher auf eine Stabilisierung hin. Die Fed wird laut Konsensmeinung keine weiteren Senkungen vornehmen, und bei der EZB sind zwar Überraschungen möglich, aber die Markterwartungen bleiben ruhig.
- Markterwartungen: Derzeit preisen die Märkte eine SNB-Zinssenkung im März von beinahe 0,25 Prozentpunkten ein. Falls diese nicht eintritt, könnte der Franken aufwerten. Doch ob Markterwartungen allein eine Zentralbankaktion rechtfertigen, ist fraglich.
- «Pulver trocken halten»: Manche argumentieren, dass die SNB ihre Zinsen möglichst hoch halten sollte, um Spielraum für künftige Senkungen zu haben. Dieses Argument überzeugt mich nicht und ist auch nicht der Grund, warum unsere Prognose oberhalb der aktuellen Markterwartungen liegt. Glaubwürdige Zentralbanken haben immer Pulver.
- Finanzstabilität und Konjunkturprognosen. Hierbei sehe ich keine wesentlichen Veränderung zu Dezember. Natürlich sind insbesondere die konjunkturellen Risiken gross. Doch Trump zu prognostizieren, wage ich nicht, und ich erachte Trump-Prognosen auch nicht für eine gute Grundlage für bedeutende Entscheide. Besser ist, sich für Eventualitäten vorzubereiten und dann rasch zu reagieren, wenn sie wirklich eintreten.
Die SNB hat in der Vergangenheit gezeigt, dass sie bereit ist, entschlossen zu handeln – sowohl bei steigender als auch bei fallender Inflation. Ihre hohe Glaubwürdigkeit resultiert gerade aus dieser Handlungsfähigkeit. Sie ist wichtiger als minimale Zinsunterschiede.
Im Dezember hat die SNB abermals ihre Bereitschaft zu dezidiertem Handeln unter Beweis gestellt. Und bis dato deuten die Wirtschaftszahlen darauf hin, dass die gewünschte Wirkung der Medizin eingetreten ist.
Fazit
Wenn der Franken nicht stark aufwertet, die Inflation nicht weiter sinkt und die EZB keine drastischen Schritte unternimmt (und Trump die Welt nicht in eine Rezession stürzt), wird die SNB den Leitzins im März unverändert lassen. Viele «Wenns» – aber so ist die Lage eben – dieses Szenario hat zumindest die höchste Wahrscheinlichkeit.