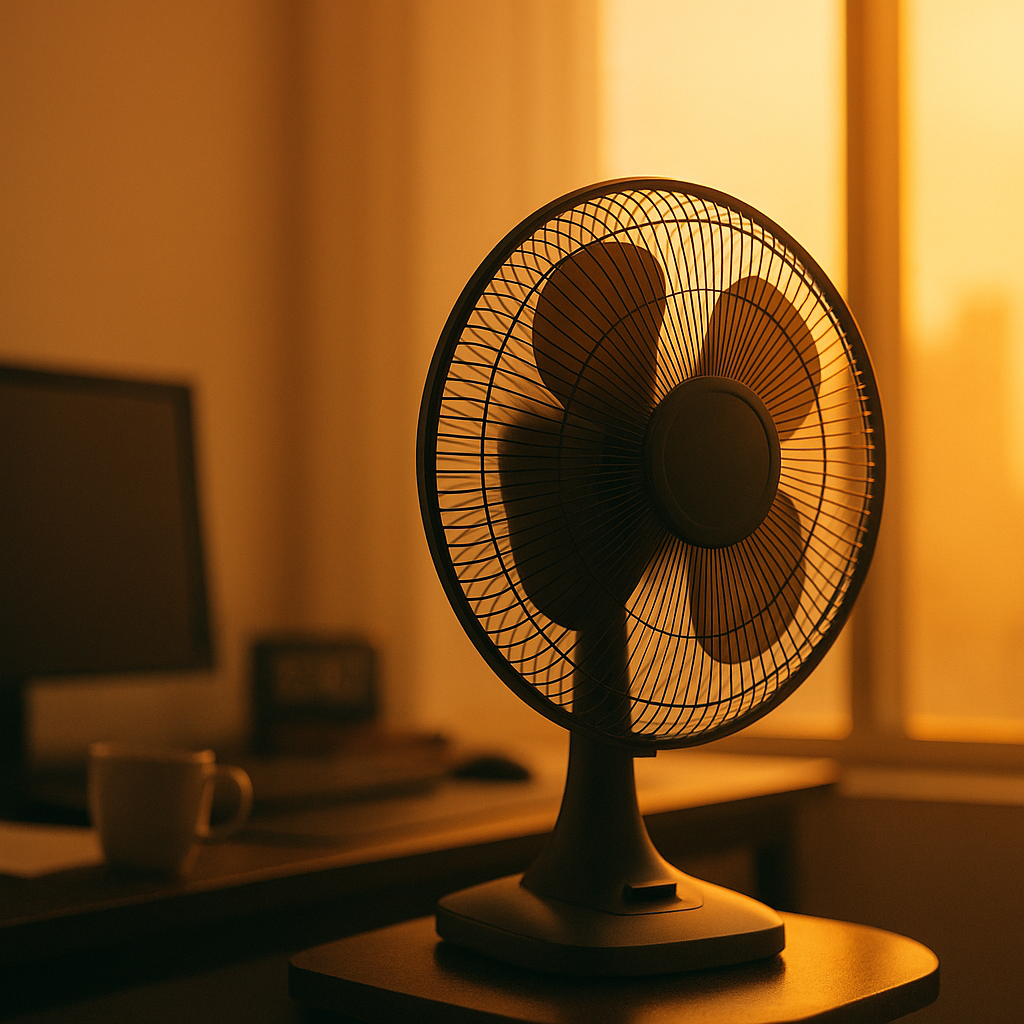In der auch geopolitisch aufgeheizten Stimmung liegt der Fokus stark beim kurzfristigen: Zölle? Kommende Woche wird es spannend. Lieferketten? Morgen vielleicht anders. Vorschriften? Morgen vielleicht weniger.
Kein Wunder, dass langfristige Themen wie Umwelt, Soziales oder Unternehmensverantwortung – also das berühmte ESG – aus dem medialen Fokus rutschen. Nachhaltigkeit ist zurzeit nicht gerade en vogue. Die EU überarbeitet gleich zwei zentrale ESG-Instrumente (CSRD und CSDDD), um Unternehmen von Bürokratie zu entlasten. Und auch in der Schweiz liebäugelt der Bundesrat mit Lockerungen, um die Wettbewerbsfähigkeit zu sichern.
Doch während in der Politik von Entlastung die Rede ist, schreiten zwei andere Entwicklungen unaufhaltsam voran: die Klimaerwärmung und der Basar an Ideen, was dagegen zu tun ist.
ESG im Rückspiegel? Nur vordergründig.
In vielen Chefetagen herrscht derzeit das Gefühl vor, dass das Regulierungspendel endlich in die «richtige Richtung» schwingt – also weg von Berichts- und Sorgfaltspflichten. Doch dieser Eindruck trügt. Regulatorische Erleichterungen sind oft nur von begrenzter Dauer. Die Geschichte zeigt: Nach jeder Deregulierungswelle folgt früher oder später das Comeback der Standards – meist nach einem Skandal oder einer Naturkatastrophe. Wer dann erst beginnt, sich mit ESG zu beschäftigen, kommt zu spät.
Was macht der Schweizer Einkauf? Wir haben nachgefragt.
Um zu verstehen, wie Schweizer Unternehmen in dieser Gemengelage agieren, haben wir von BAK Economics gemeinsam mit procure.ch die Teilnehmenden der PMI-Umfrage befragt. Der Fokus: ESG-Daten in der Lieferkette – insbesondere Scope-3-Emissionen.
Die Ergebnisse zeigen: Das Thema ist im Einkauf angekommen. In der Industrie erfassen bereits 22 % der Unternehmen Umweltdaten ihrer Lieferanten, weitere 12 % planen es. Auch der Dienstleistungssektor liegt mit 18 % aktiver und 13 % geplanter Erhebung nicht weit dahinter. ESG ist also kein Papiertiger, sondern bereits gelebte Praxis – zumindest bei einem Teil der Unternehmen.
Der Druck kommt von vielen Seiten – und nimmt zu
Woher kommt der Anstoss? Gemäss Umfrage vor allem aus Brüssel. Die EU-Regularien sind für Schweizer Unternehmen mit EU-Geschäft faktisch verbindlich. Auch nationale Vorgaben spielen eine Rolle. Und nicht zu unterschätzen: 60 % der Industriebetriebe spüren deutlichen oder zumindest moderaten ESG-Druck von Kundenseite. Banken und Investoren? Noch verhaltener – aber bekanntlich springen diese rasch auf einen Trend auf, wenn er anrollt.
Scope 3: Viel Aufwand, wenig Struktur
Klingt gut? Leider nur auf den ersten Blick. Denn bei der konkreten Erfassung der CO₂-Emissionen ihrer Lieferanten agieren viele Unternehmen noch nach dem Prinzip «Pi mal Daumen»: Knapp 60 % nutzen eine Mischung aus Schätzungen und freiwilligen Lieferantenangaben. Nur eine Minderheit setzt auf standardisierte Tools oder Prozesse. Und bei der Unterstützung der Lieferanten zeigt sich ein ähnliches Bild: Nur rund die Hälfte der Firmen, die Umweltdaten erfassen, hilft den Lieferanten dabei – meist durch Beratung. Digitale Tools oder standardisierte Vorlagen sind kaum im Einsatz.
Angesichts der Tatsache, dass über 75 % der Industrieunternehmen mehr als 100 Lieferanten haben – 10 % sogar über 1’000 –, ist das ein massives Effizienzproblem. Wer jedes ESG-Datenblatt manuell hinterfragt, wird nie zu einem schlanken, skalierbaren Reportingprozess kommen.
Deregulierung ist ein kurzfristiger Bonus – aber kein Zukunftsmodell
Kurzfristig mag das regulatorische Tauwetter Entlastung bringen – wirtschaftlich wie politisch. Doch mittelfristig dürfte sich der Wind wieder drehen. Die Gründe sind klar: Das Klima wartet nicht. Menschenrechte sind keine Modefrage. Und Märkte – vor allem internationale – verlangen nach vergleichbaren Standards.
Unternehmen, die heute in digitale ESG-Prozesse investieren, sind morgen nicht nur regulatorisch auf der sicheren Seite, sondern sichern sich auch einen Wettbewerbsvorteil. Ein strukturierter, effizienter Umgang mit Scope-3-Daten wird zum strategischen Asset – ob man will oder nicht.
Fazit? Wer ESG aufschiebt, handelt kurzsichtig. Das Regulierungsgespenst wird früher oder später aus dem Hitzekoma erwachen. Wer jetzt auf einfache, digitale Lösungen setzt, kann dessen Rückkehr entspannt erwarten. Nur: Solche Lösungen sind derzeit noch rar. Aber der Bedarf ist offensichtlich.