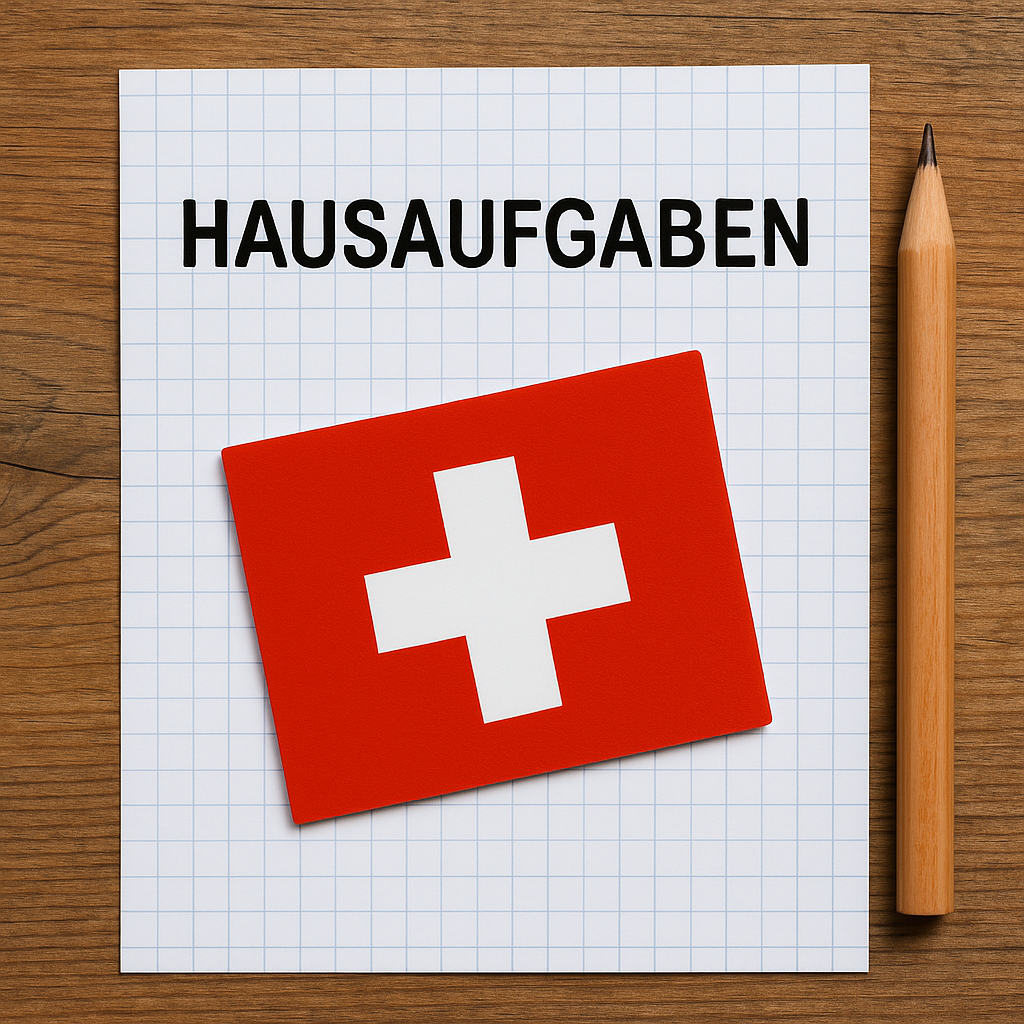Vor einigen Wochen habe ich zur AHV eine einfache Zahle ins Zentrum gestellt (LINK): Die AHV schreibt pro Kopf und Jahr ein Defizit von rund 11’000 Franken. Auf ein ganzes Leben betrachtet, wird das strukturelle Ungleichgewicht noch deutlicher:
- 46 Beitragsjahre: 328’000 Franken Einzahlung
- 21.5 Bezugsjahre: 379’000 Franken Rente
- Lebensdefizit: 51’000 Franken pro Person
Dieses Defizit ist kein Zufall. Es ist Teil der Architektur. Die AHV war nie ein rein versicherungstechnisches Umlageverfahren. Sie war immer ein politischer Kompromiss – zwischen Jung und Alt, Frauen und Männern, Erwerbstätigen und Rentnerinnen und Rentnern, zwischen Staat und Bevölkerung. Daran will niemand ernsthaft etwas ändern. Aber: Die Balance muss stimmen.
Die Frage ist nicht, ob ein Defizit zulässig ist. Sondern: Wie gross darf es sein – und wie finanzieren wir es?
Drei Stellschrauben – ökonomisch unvermeidlich
Rein rechnerisch gibt es nur drei Wege, ein strukturelles Defizit zu korrigieren:
- Mehr Beiträge
- Weniger Leistungen
- Höheres Rentenalter
Das sind ökonomisch logische Stellschrauben – politisch aber höchst umstritten, um es wohlwollend zu formulieren.
Ein Defizit ist erlaubt – aber nicht jedes
Klar ist: Das strukturelle Defizit wird nicht verschwinden – es ist explizit vorgesehen. Der Bundesbeitrag ist keine Notlösung, sondern fest im Modell verankert. Doch auch hier gilt: Die Balance zählt. Wird das Defizit zu gross, kippt das System – finanziell, politisch, gesellschaftlich.
Die Diskussion darüber muss angesichts der Dimension des strukturellen Defizits von 51 000 CHF pro Person (das macht in einer 8-Millionen Schweiz ein Betrag von 400 Mrd. CHF) ehrlicher, klarer und intensiver geführt werden.
Was wird diskutiert – und was bringt es?
Die Reformvorschläge sind bekannt – viele davon seit Jahren:
Einnahmeseite (Kompensation):
- Beitragserhöhungen bei Arbeitnehmern und Arbeitgebern
- Mehrwertsteuer
- Höhere Bundesbeiträge
- Teilweise Kapitaldeckung
- Sonderabgaben (z. B. CO₂, Finanztransaktionen)
Ausgabenseite (Modulation):
- Rentenalter erhöhen
- Rentenhöhe dämpfen
- Auslandrenten differenzieren
- Anreize für längeres Arbeiten
- Verwaltungskosten senken, Anlagerendite optimieren
Hier sind wir Ökonominnen und Ökonomen gefragt: Vor- und Nachteile aufzeigen. Sachlich, nüchtern, transparent. Denn: Die Politik braucht Fakten – nicht Stimmungen.
Zwischen Ökonomie und Politik – ein realistisches Paket
Dazu gehört auch: Den Elfenbeinturm zu verlassen.
Ein rein ökonomisch optimiertes System wäre effizient – aber politisch chancenlos.
Ein rein politisch bequemes System wäre populär – aber nicht finanzierbar.
Realistisch ist ein ausbalanciertes Paket:
- Ein Mix aus strukturellen Anpassungen
- Flankiert durch eine tragfähige staatliche Beteiligung
- Sozialpolitisch abgestützt – etwa durch gezielte Kompensation für Haushalte mit tiefen Einkommen
Denn genau darum geht es: nicht um technische Perfektion oder einen «gerissenen deal» zu Gunsten der Lautesten, sondern um politische Tragfähigkeit. Nutzen wir den Ärger über die US-Disruptionen als Antrieb für Hausaufgaben im eigenen Land – mit einem typisch schweizerischen Kompromiss, der fair ist. Auch für kommende Generationen.