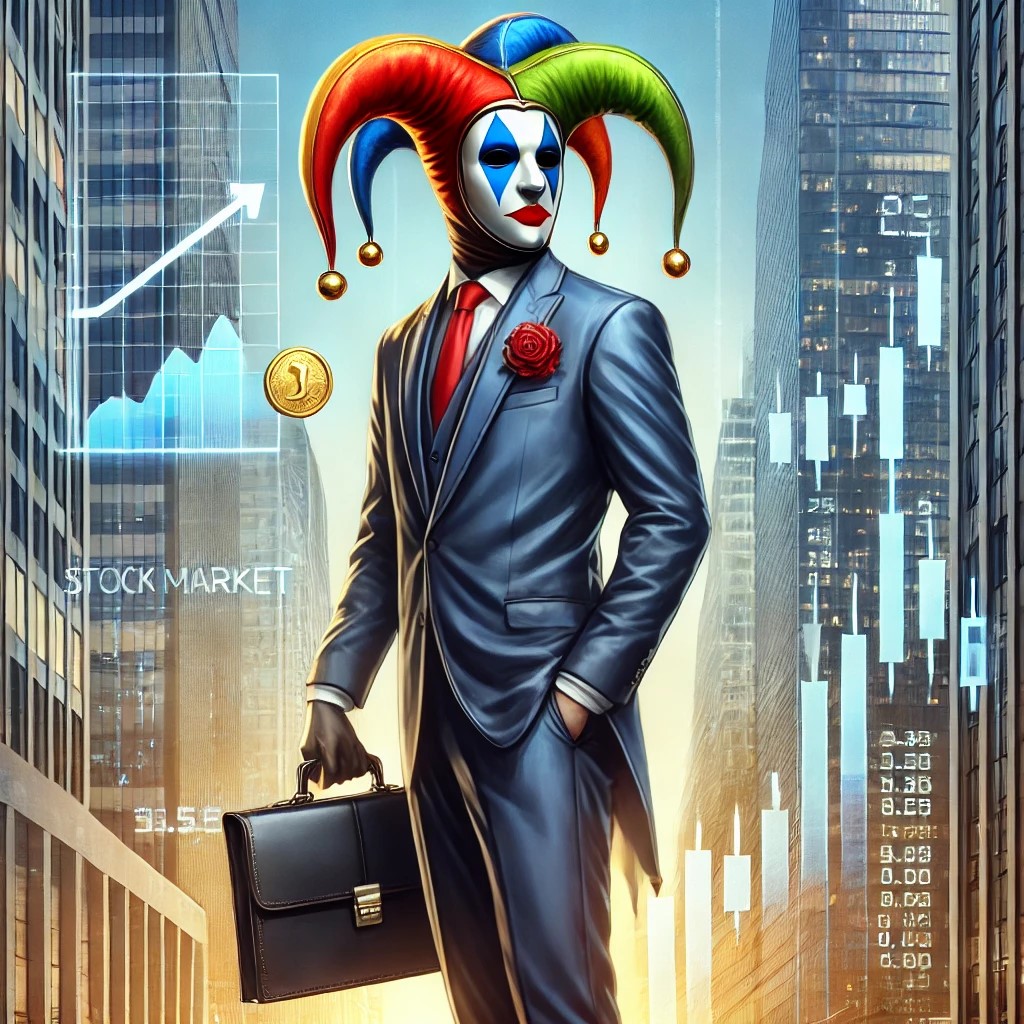Der Blog-Beitrag über Bitcoin von Mitte Januar hatte interessante Diskussionen zur Folge, unter anderem auch in den sozialen Medien. Ich danke allen, die sich positiv zu meiner Analyse und meinen Einschätzungen geäussert haben. Noch mehr jedoch möchte ich allen Kritikern danken. Zugegeben, auch ich bin eitel und empfinde es als unangenehm, wenn jemand meine Meinung infrage stellt. Aber ich bin von der tiefen Überzeugung, dass Ökonomen nur dann Mehrwert bieten, wenn sie eine Art «Hofnarr-Rolle» innehaben. Das bedeutet, mit möglichst scharfer Analyse den Spiegel vorzuhalten, ungeachtet von Emotionen.
Ich möchte daher den Blog nutzen, um auf ein paar der aufgeworfenen Kritikpunkte einzugehen:
Kritik: Worte wie «Optionen» und «Wetten» haben negative Prägung
Die Aussage, dass Bitcoin einer Option gleichzusetzen ist, greift ohne Erklärung von Optionen als Finanzinstrument tatsächlich zu kurz. Es stimmt zwar, dass Optionen vereinfacht gesagt eine Wette auf das Eintreffen eines Ereignisses sind. Tritt das Ereignis ein, gewinnt man mit kleinem Einsatz viel; wenn nicht, verliert man als Käufer von Optionen unter Umständen den Einsatz und als Verkäufer im schlimmsten Fall noch mehr.
Doch «Wette» hat emotional eine äusserst negative Prägung, was zu einer übermässig negativen Sicht auf Bitcoin und generell Optionen führen kann. Eigentlich sind auch meine Feuer-, Diebstahl- oder Wasserschadenversicherungen nichts anderes als solche Wetten. Brennt mein Haus oder werde ich bestohlen, erhalte ich mehr Geld zurück, als ich eingezahlt habe. Wenn nicht, verliere ich alle Prämien, die ich bezahlt habe. Wenn Wetten als Versicherungen betrachtet werden, sind sie unbestritten nützlich.
Auch in der Finanz- und Exportindustrie sind Versicherungen wichtig, beispielsweise gegen eine Aufwertung des Frankens. Viele Schweizer Exportunternehmen bauen grossartige Maschinen, doch, wenn sie sich nicht gegen Währungsschwankungen absichern, sind sie eigentlich auch Währungsspekulanten. Absicherungsinstrumente wie Forwards oder Optionen erlauben es, massgeschneiderte Versicherungen zu erstellen, die auf das Risiko-/Ertragsprofil eines Unternehmens eingehen. Bezogen auf Bitcoin bedeutet dies, dass je nach Risikoappetit und Möglichkeiten eine Anlage in diese «Technologie und Weltbild Option» als Beimischung sinnvoll sein kann. Bei mir ist sie dies aber nicht.
Kritik: Fiat-Money ist auch nicht gedeckt
Häufig genannt wurde Kritik am Fiat-Money Zentralbankgeld. Unser herkömmliches Geld ist tatsächlich nichts anderes als eine soziale Norm. Selbst der Schweizer Franken ist nur theoretisch durch die Bilanz der Schweizerischen Nationalbank (SNB) gedeckt. Eine Hunderternote ist zwar eine Schuld der SNB (auf der Passivseite der Bilanz verbucht) und in der Bilanz stehen auf der Aktivseite die gleiche Summe an Assets der Passivseite gegenüber. Doch kann ich nicht zur SNB gehen und meine Hunderternote gegen Aktiva der SNB eintauschen. Der Wert einer Hunderternote ergibt sich somit nur durch das Vertrauen in die SNB und das Vertrauen, dass die SNB ihren Auftrag erfüllt.
Die Wirtschaftsgeschichte zeigt, dass die Unabhängigkeit einer Zentralbank wichtig ist für das Vertrauen in eine Währung. In der Schweiz ist diese in der Verfassung und im Nationalbankengesetz geregelt. So weit so gut, doch gibt es hierzulande keine Verfassungsgerichtsbarkeit, womit die SNB ihr Recht auch durchsetzen kann. Die SNB ist somit nur unabhängig, weil das Parlament und der Bundesrat dies auch so wollen (und wohl auch das Volk). Helfen tut der SNB hingegen ihr klares Mandat: Sie muss nur die Preisstabilität wahren und nicht noch die Welt und Banken retten (auch wenn das wichtig ist, doch das können andere besser). Je einfacher ein Auftrag ist, desto einfacher ist er zu erfüllen.
Wohlwollende Diktatoren gibt es nur noch in Zentralbanken
Ökonomisch schwierig zu erklären ist indes, warum die Zentralbank ihren Auftrag gewissenhaft erfüllt. Ökonomen erklären die Welt mittels Analyse der Anreize. Und diese sind für Zentralbankerinnen und Zentralbanger, gelinde gesagt, unklar. Um eine Geldentwertung – Inflation – zu verhindern, müssen Zentralbanken mittels hoher Zinsen die Wirtschaft bremsen. Hohe Zinsen und niedrigeres Wirtschaftswachstum sind selten im Sinne der Regierung. Dies hat sich exemplarisch am WEF in Davos gezeigt, als Donald Trump recht explizit tiefere Leitzinsen in den USA gefordert hat.
Auch viele Unternehmen haben im Tagesgeschäft lieber eine schwächere Währung und tiefere Zinskosten. Tiefe Zinsen sind wiederum ein Anliegen, das auch Immobilienbesitzer und -besitzerinnen teilen. Und aufgrund der Koppelung der Mieten an den Referenzzinsatz sind selbst Mieterinnen und Mieter froh um tiefe Zinsen. Kurz: Ausser bei weniger betuchten Haushalten und ein paar Ökonomen machen sich Zentralbanken mit einer expansiven Geldpolitik mehr Freunde als bei restriktiver – zumindest, solange die Inflation einigermassen im Zaum bleibt und die Zinsen nicht zu tief im negativen Bereich sind.
Warum handeln Zentralbanken aber doch besonnen in ihrem Auftrag? Ich hatte das Privileg, in meiner Studienzeit bei Thomas Jordan Vorlesungen just zu diesem Thema zu besuchen. Ich erinnere mich, dass die Vorlesung äusserst fakten- und theoriebasiert war. Doch genau bei der Antwort auf obige Frage wurde Jordans Fazit schwammig: Zentralbanken ziehen Mitarbeitende an, die intrinsisch motiviert sind, ihren Auftrag zu erfüllen.
Ich behaupte nicht, dass dies nicht stimmt. Doch muss ich den Zweiflern am heutigen Geldsystem durchaus einen Punkt zugestehen. In anderen Bereichen hat die Volkswirtschaftslehre zu Recht Abstand genommen vom «Wohlwollenden Diktator», der aus intrinsischer Motivation das soziale Optimum aus seiner Macht macht.
Kritik: Zentralbankbilanz besteht aus Schulden und Blasen
Kritiker am heutigen Geldsystem wenden zudem häufig ein, dass die SNB-Bilanz ebenfalls nur aus Schulden besteht. Das stimmt. Der Blick auf die Aktivseite der SNB-Bilanz zeigt; rund zwei Drittel besteht aus Staats- und anderen Anleihen – also Schulden. Rund ein Fünftel aus Aktien. Und rund 9% der Bilanz besteht aus Gold. Gold gilt als Stabilitätsanker einer Zentralbank. Doch bei genauer Betrachtung hat Gold kaum Wert, der Preis für die industrielle Verwendung ist sicherlich deutlich unter dem Marktwert.
Ich halte es daher in Bezug auf Gold mit dem früheren Professor der London School of Economics William Buiter: «Gold ist die längste Spekulationsblase der Menschheit». Der Wert von Gold ergibt sich aus Knappheit und dem Glauben an den Werterhalt des Goldes. Der Unterschied zu Bitcoin? Gold ist schlicht «too big to fail». Es gibt Milliarden von Besitzerinnen und Besitzern. Wenn der Preis sinkt, finden sich immer neue Käuferinnen und Käufer. Oder, in den Worten von Buiter; «Gold wird bereits seit 6000 Jahren als Wertanlage verwendet, daher ist es gut möglich, dass es nochmals 6000 Jahre genutzt wird».
Kritik: Tech-Aktien sind auch «Optionen»
Häufig kam in der Diskussion auch der Hinweis, dass die Volatilität von Bitcoin tendenziell sinkt, während die von Aktien in den USA steigt. Gerade diese Woche hat Anlegerinnen und Anleger vor Augen geführt, dass der «Goodwill» in gewissen Tech-Aktien tatsächlich auch als Option auf zukünftige Gewinne angesehen werden muss. Dies ist der Fall, wenn die Bewertungen deutlich über dem Unternehmenswert liegen. Im Gegensatz zu Bitcoin besteht jedoch immerhin eine Grundsubstanz, auch wenn diese teilweise weit unter dem Marktwert liegt.
Unbestritten bleibt derweilen das Argument, dass sich Unternehmenswerte niemals exakt berechnen lassen. Ich beneide zwar die Kollegen aus der Aktienanalyse. Wenn ihre Prognose nicht stimmt, heisst es in den Medien: «Das Unternehmen hat die Erwartungen der Analysten nicht erfüllt.» Bei anderen Prognostikern ist das Urteil deutlich strenger: Das Wetter verpasst ja nicht die Prognose der Meteorologen, sondern die Prognose war schlicht falsch. Dasselbe ist auch bei uns Ökonomen der Fall. Doch liefern Unternehmen derart häufig ihre Bilanz und Erfolgsrechnungen, dass der Substanzwert einigermassen richtig eingeschätzt werden kann und sicherlich besser als bei Gold oder Bitcoin, sofern es einen gibt.
Mein Fazit:
Auch wenn sich zahlreiche Kritikpunkte am heutigen Geldsystem entkräften lassen, weist selbst Zentralbankgeld Schwächen als Wertaufbewahrungsmittel auf. Überhaupt gibt es kein «ideales Wertaufbewahrungsmittel». Es ist daher wichtig, die jeweiligen Vor- und Nachteile zu kennen, ebenso die eigenen Ziele und den eigenen Risikoappetit. Ich selber verwende Bitcoin nach Abwägen aller Argument nicht.